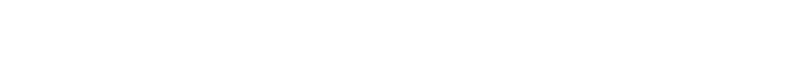Buchrezension von Kurt Bangert, erschienen in: Freies Christentum Jg. 67, Heft 6 (Nov-Dez), S. 161-165
Gott als das Ganze bzw. als das Integral von Mensch und Welt
Volker Gerhardt: Der Sinn des Sinns – Versuch über das Göttliche, C. H. Beck: München 2015,
340 Seiten (ISBN: 978-3-406-66934-7), 29,95 Euro.
Das Buch des inzwischen emeritierten Professors an der Berliner Humboldt-Universität ist der bemerkenswerte Versuch eines zeitgenössischen Philosophen, sich mit dem Gottesbegriff oder, wie der Autor es bevorzugt, mit „dem Göttlichen“ auseinanderzusetzen. Die Gottesfrage, die in der alten Philosophie ein immer wiederkehrendes Thema war, ist unter Philosophen heutzutage weitgehend aus dem Blickfeld geraten. Und dennoch gilt, was der große Philosophie-Kenner Wilhelm Weischedel (1905–1975) einst über die Beschäftigung mit der Frage nach Gott schrieb: „Gibt die Philosophie diese ihre wesentliche Aufgabe preis, so gibt sie offenbar sich selber auf.“[1] Volker Gerhardt sieht in der Frage nach Gott „sogar den Anfang des Philosophierens“ (S. 69). Indem Gerhardt die Frage nach Gott stellt und auch überzeugend zu beantworten sucht, befasst er sich immer wieder mit dem Wesen des Glaubens und dessen Verhältnis zum Wissen. (Er spricht von „Glauben“ statt von „Glaube“, weil das substantivierte Verb dem tätigen Vollzug näher steht als das Nomen). In dem flotten Spruch „Glaubst du noch, oder denkst du schon?“ einiger deutscher Atheisten wie Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung erkennt Gerhardt einen unzulässig konstruierten Gegensatz zwischen Glauben und Wissen (S. 42). Denn jeder Mensch glaubt irgendetwas, „sobald er ernsthaft etwas tut oder lässt“ (S. 1). Glauben sei ein existenzieller Akt, der das Ganze eines Individuums umfasst und immer dann beginnt, wenn das Wissen eines Menschen an seine Grenzen stößt (S. 2). „Nichts ist dümmer als der Glauben, man könne den Glauben durch Wissen überwinden.“ (S. 60) „Es wäre eine kaum zu überbietende Form des Unwissens, anzunehmen, man könne sich alle Gegenstände des Glaubens in der Münze des Wissens auszahlen lassen.“ (S. 175)
Aber umgekehrt sei es auch nicht ratsam, den Glauben nur jenen zu überlassen, die meinen, man könne allein aus der Perspektive des Glaubens leben. Denn „wann immer einer selbst- und weltbewusst mit seinem Wissen umgeht, vertraut er auf Rahmenbedingungen seines Wissens, zu denen ein Glauben gehört“ (S. 60). „Also glaubt jeder Mensch, der etwas weiß, und er glaubt ausnahmslos, dass ihm dieses Wissen etwas bedeutet.“ (S. 175) Diese Option für das Wissen beruht auf dem Gefühl (und Glauben ist wesentlich ein Gefühl), das wir als Glauben an das Wissen bezeichnen können (S. 185). Denn für Gerhardt ist der Glauben etwas, „das sich wesentlich auf den Umgang mit dem Wissen bezieht“ (S. 192). Der Mensch kann viel wissen und sein Wissen stets ausweiten, aber je mehr er weiß, desto mehr ist er zu erkennen genötigt, „nicht alles wissen zu können“ und sich einzugestehen, „dass dies immer so bleiben wird“. Und darum gilt: „Der Glauben als Einstellung zum Wissen kann somit nicht als zeitweilige Ersatzvornahme verstanden werden, die sich erledigt, sobald das Wissen auch die Bereiche abdeckt, die den Menschen mit Blick auf seine Gewissheit in existenziellen Fragen interessieren. Der Glauben muss vielmehr als eine grundsätzliche Kompensation dessen gesehen werden, was das Wissen gerade dem Wissenden versagt.“ (S. 193)
Nicht nur der Glauben spielt für den Menschen eine entscheidende Rolle, auch das Göttliche „ist eine Macht im menschlichen Leben“ (S. 11), zumal „die Gegenwart Gottes nirgendwo anders als im Selbstverständnis des Menschen liegt“ (S. 16). Doch das unmittelbare Gegenüber des Menschen ist nicht Gott, den er nicht sieht, sondern die Welt, zu der er gehört und mit der der Mensch schicksalhaft verbunden ist. Dass der Mensch überhaupt von „der Welt“ reden kann, ist ein Proprium nur des Menschen, der nicht nur von beobachtbaren Sachverhalten ausgeht, sondern die Welt als ein Ganzes zu denken vermag. Und indem er die Welt als ein Ganzes denkt und zu verstehen sucht, unterstellt er ihr gewissermaßen auch einen Sinn – zumal für sich selbst. „Die Sinndimension ist die Voraussetzung dafür, in der Welt überhaupt nach einem Sinn suchen zu können.“ (S. 22) Von diesem Sinn handelt Gerhardts Buch. Das Buch geht davon aus, „dass sich das Ganze des Menschen nur als das zugehörige Gegenüber des Ganzen der Welt begreifen lässt. Beide zusammen können als das sinntragende Ganze verstanden werden. Und erst bei diesem alle erlebten und erdachten Ganzheiten umfassenden Ganzen sind wir dem Begriff des Göttlichen nahe.“ (S. 25). In der Bezogenheit des Ganzen der Welt auf das Ganze von Individuen sieht Gerhardt die Göttlichkeit eines alles umfassenden Sinns. „Ohne Sinn bleibt die Welt ein Sammelsurium von Gegenständen und Vorgängen, von Daten und Fakten, die weder untereinander noch mit uns […] verbunden sind. […] Der ‚Sinn des Sinns‘ verbindet alle im Einzelnen gegebenen Bedeutungen derart, dass sie im Ganzen eine Bedeutung für die Individuen haben können, die sich darin selbst als ganze zu erhalten und zu entfalten haben.“ (S. 29)
Weil wir die Welt als Ganzes aber nicht vollständig zu denken vermögen, können wir an dieses Ganze der Welt – an dieses Eine, dieses All, diese Natur, diese Wirklichkeit, dieses Sein – nur glauben. „Es ist das Ganze der Welt, der gegenüber das Ganze eines Individuums zu seiner einzigartigen Bedeutung gelangt.“ (S. 45) Der Begriff der „Welt“ eröffnet einen großen „Bedeutungsraum“, der alles einschließt: das Sein, die Zeit, den Raum, die Wirklichkeit, die Möglichkeit, ja sogar das Nichts, „sofern wir es als Lücke verstehen, [welche] die existierenden Dinge lassen“ (S. 245). In Wahrheit ist die Welt „aber nur ein Gedanke, der alles zusammenfasst“ (S. 245). Gleichwohl hat dieser Gedanke von der Welt als einem Ganzen für den Menschen und seine individuelle Existenz offenbar eine immense Bedeutung. Dieses Ganze der Welt, das dem Ganzen des Individuums in einer Bedeutung stiftenden Weise gegenübersteht, belegt Gerhardt mit dem Ausdruck des Göttlichen. „Es ist der Vorzug des Gottesbegriffs, dieses Ganze des Daseins in umfänglicher Weise zum Ausdruck zu bringen.“ (S. 46) Mit dem Begriff des Göttlichen habe der stets in Beziehungen lebende Mensch kein Problem mehr, „sich selbst als integralen Teil des Ganzen und dennoch als eigenständig zu begreifen“ (ebd.). „Das Göttliche ist das Ganze der Welt – potenziert durch das Ganze, als das sich der Mensch versteht […]. Gott ist die Einheit, in der sich Mensch und Welt gegenüberstehen.“ (S. 48) Und sobald wir an Gott glauben, „ist darin der intellektuelle Selbst- und Weltbezug primär“ (S. 52). „Für den Gläubigen ist Gott die Welt, mit der man eins sein kann.“ (S. 199)
Wer den Sinn seines Lebens im Verhältnis zum Ganzen der Welt bestreitet, wird nach Gerhardt „als verlässlicher Partner, als Familienmitglied, als Bürger oder Freund, als Lehrer oder Vorgesetzter“ kaum in Frage kommen können (S. 61). Will der Mensch seinem Leben aber einen Sinn geben, „muss er an eine Korrespondenz zwischen Person und Welt glauben“ (ebd.). Also nimmt er die Welt, die ihm etwas bedeutet, „als ein Ganzes an, in dem er selbst als Ganzer Geltung beansprucht“ (ebd.). „Und diese Entsprechung, die sich weder als bloß weltlich noch als rein subjektiv bezeichnen lässt, kann im Einklang mit einer großen Tradition als göttlich begriffen werden. Damit wird das Göttliche zur Bedingung eines jeden möglichen Sinns, den der Einzelne aus guten Gründen zu verfolgen sucht. Unter der Prämisse der Anerkennung des eigenen Sinns kann er das Göttliche als den Sinn des Sinns verstehen.“ (ebd.) „Göttlich ist somit das, in dessen Licht wir uns erkennen.“ (S. 78) „Das Göttliche ist das Integral von Mensch und Welt.“ (S. 287) Der Glauben ist „Ausdruck des Vertrauens, das ich als Teil der Welt, als Mensch und als Person in das Weltgeschehen habe. Und Gott ist der Name für den in diesem Vertrauen liegenden Sinn […].“ (S. 313) Der Glauben zielt auf die „Sinneinheit von Mensch und Welt“, in der jeder Einzelne versucht, „ihr bewusst zu entsprechen, ihr gerecht zu werden und ihrer würdig zu sein“ (S. 113). Das ist die Grundthese des Buches. Mit dieser Definition des Göttlichen ist freilich auch klar, dass der so verstandene Gottesbegriff für Gerhardt nicht als Transzendenz im Sinn einer Region jenseits der Welt zu verstehen ist (S. 48). Vielmehr gilt: „Gott wird in der Welt benötigt!“ (S. 54)
Ausgehend von der Ideenlehre Platons, nach der das eigentlich Wirkliche die Idee sei, ist für Gerhardt „auch Gott eine Idee, die sich nur dem erschließt, der in der Selbst- und Welterkenntnis von seiner eigenen Einbindung in den Zusammenhang des Ganzen weiß“. „So ist die Frage, ob Gott existiert, so unangemessen wie die Frage, ob denn das Ganze wirklich gegenwärtig ist. Gott ist in seinem Wirken – und nirgendwo sonst.“ (S. 84). Auch nach Kant gibt es Gott nicht im Sinne eines empirischen Sachverhalts, „wohl aber im Sinn einer moralischen Größe, an die man bereits glaubt, wenn man davon ausgeht, dass ein unter ethischen Prinzipien geführtes Leben auch im Ganzen des Daseins nicht sinnlos ist“ (S. 98). Gott ist „kein Sachverhalt, kein Einzelding und somit auch kein ins unermesslich Große gesteigertes Lebewesen“ (S. 217 f.). „Als wahrhaft transzendentes Wesen wäre er vollkommen für sich und könnte denen, die an ihn glauben, noch nicht einmal etwas bedeuten, außer vielleicht, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit das vollkommen Andere und notwendig Fremde bliebe. Man müsste sich ein für alle Mal eingestehen, dass es sinnlos wäre, ihn anzurufen oder zu verehren […]. Also ist es ausgeschlossen, Gott derart im Jenseits zu verorten, dass er gar nicht zur Welt gehört.“ (S. 223) Gott muss deshalb als ein „Moment der Welt“ angesehen werden. „Als Gott, der uns etwas angeht, kann er nur zu unserer Welt gehören.“ (ebd.) Und deshalb „hat er mit der Welt, in der wir sind, eins zu sein“ (S. 224). Das Göttliche ist somit etwas, „das mit und in der Welt wirksam ist“ (S. 228). Gott ist weder ein Etwas in der Welt noch ein Etwas außerhalb der Welt. „Gott kann nur die Welt bedeuten, in der wir selber sind […]. Gott steht für die Welt, in der wir uns verstehen – in der wir uns, trotz allem, zu Hause wissen […].“ (S. 230)
Indem der Mensch die Welt in ihrer Ganzheit als göttlich begreift, gibt er diesem Ganzen der Welt „einen Wert, der die bloße Summe seiner Teile überschreitet, wächst er selbst mit, auch wenn er nur ein Teil des Ganzen ist“. In der bewussten Anerkennung des Ganzen liegt eine Aufwertung seiner Teile (S. 213). „Dem Teil, der da denkt, kann das Ganze, das er denkt und zu dem er (irgendwie) gehört, nicht gleichgültig sein.“ (S. 212) Das heißt: Die Welt geht uns etwas an! Und sie geht uns deshalb etwas an, weil wir selbst ein Teil der Welt sind. „Der Mensch verlangt nach Sinn in einer Welt, die ihm von sich aus keinen Sinn zu bieten vermag.“ (S. 259 f.) Unser Wissen über die Welt bzw. über Teile unserer Welt ist nicht geeignet, uns einen Sinn dieser Welt nahezulegen. „Auf die Fragen: Wozu die Welt da ist? und Wozu du Einzelner da bist? bietet das Wissen keine Antwort.“ (S. 233) Doch können wir Menschen diese Frage nach dem Sinn des Daseins nicht, wie Nietzsche, einfach offen lassen. Vielmehr sei dies, so Gerhardt, eine existenzielle Frage des Glaubens. Der Sinn der Welt, welcher der Mensch seine Existenz verdankt, kann in der Einheit von Mensch und Welt gesehen werden. Dies ist der Sinn, „den die Welt zulässt und den der Mensch als erfüllt oder erfüllbar ansehen kann“ (S. 235). Diesen Sinn kann der Glauben ergreifen. Der Mensch hat an die Welt zu glauben, wenn er in ihr bestehen will. „In diesem Glauben, in diesem Weltvertrauen, lebt der Mensch, sofern er bewusst lebt.“ (S. 238) Und der Glauben an Gott bietet sich allen an, „denen das Selbst- und Weltvertrauen in den alltäglichen Dingen nicht genügt“ (S. 273). Uns „so muss man den Glauben an Gott als die alles umfassende und zugleich persönlich wirksame Garantie des Glaubens an die Welt und an sich selbst verstehen. Wir glauben nicht um Gottes willen, sondern wir glauben an Gott um der Welt und des Menschen willen.“ (S. 274)
An Gott wird nach Gerhardt geglaubt „wie an ein Wesen, das es in und mit der Welt gibt“ (ebd.). Gott kann als die Stimme begriffen werden, „in der sich die Welt dem Individuum mitteilt“ (S. 277). Gott ist der Name für den Sinn der Welt (ebd.). „Ohne diesen Sinn würde das Ganze der Welt mitsamt seiner einzelnen Teile ohne Bedeutung für uns sein. Allein damit ist die Rede vom Göttlichen als dem Sinn des Sinns gerechtfertigt.“ (S. 279) Und deshalb sei es nicht abwegig, auch vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse vom Göttlichen – und sogar von Gott – zu sprechen; ja sogar zu Gott als unserem sinngebenden Gegenüber zu sprechen wagen, sofern wir dieses Gegenüber nicht verdinglichen oder uns als physische Entität vorstellen. Dass Gerhardt mit seiner weit gefassten und undogmatischen Gotteslehre indirekt auch die Fragwürdigkeit eines allzu platten Atheismus als obsolet entlarvt, sei hier auch noch herausgestellt.
Ich habe dieses Buch mit großem Gewinn gelesen, zumal Gerhardts Thesen in wesentlichen Punkten auch meinen eigenen Gottesvorstellungen entsprechen.[2] Gerhardt ist weit davon entfernt, einem traditionellen, dogmatischen Christentum das Wort zu reden, legt aber beredtes Zeugnis davon ab, dass das Göttliche zwar kein wie auch immer beschaffener Gegenstand ist, aber doch als „eine Macht im menschlichen Leben“ (S. 11) wahrgenommen und ernst genommen werden kann. Gerhardt selbst war zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn aus der Kirche ausgetreten, trat aber aufgrund eigenen Nachdenkens nach 25 Jahren wieder in dieselbe ein – und zwar „mit dem Glück eines Menschen, der etwas Verlorenes wiedergefunden hat“ (ebd.). Dass die den Gottesgedanken propagierenden christlichen Kirchen der Idee ihrer Gründung oft genug Gewalt angetan haben, verkennt der Autor nicht. Das sollte aber den Blick „für die kulturgeschichtlichen Leistungen der christlichen Kirchen nicht verstellen“ (S. 304). Keine andere Religion habe die rationalen Kräfte der globalen Weltkultur so gefördert wie das Christentum (ebd.). Gleichwohl: „Die Kirche hat im eigenen Wirken ein Beispiel für das zu geben, was sie lehrt.“ (S. 299)
Kurt Bangert
[1] Wilhelm Weischedel: Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus, Band 1, dtv wissenschaft: München 1979, S. XVIII.
[2] Kurt Bangert: Die Wirklichkeit Gottes. Wie wir im 21. Jahrhundert an Gott glauben können, Philia: Bad Nauheim 2012/2015.